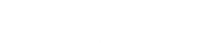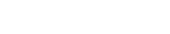Ein fiktives, aber gar nicht so unwahrscheinliches Szenario: Eine D2C-Marke aus Deutschland verkauft erfolgreich Nahrungsergänzungsmittel über Shopify. Nach Monaten stabilen Wachstums trudeln plötzlich Bestellungen aus Frankreich, Polen und Schweden im Store ein. Zunächst herrscht Begeisterung im Team: „Das ist unser internationaler Durchbruch! Das müssen wir ausnutzen! Lasst uns Shopify Markets einschalten und einfach weiter alle Preise in Euro anzeigen.“
Die Ernüchterung folgt direkt im Anschluss. Die Conversion Rates in den internationalen Stores sind miserabel, die Buchhaltung kämpft mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen, das ERP-System versteht die neue Datenvielfalt nicht, der Support probt den Aufstand, weil er komplett überfordert ist, und im Briefkasten liegen Abmahnungen wegen fehlender Rechtstexte. So sollte das mit der Internationalisierung nicht laufen …
Falls du dich gerade in einer ähnlichen Situation befindest, stellt sich also die Frage: Willst du mit Shopify wirklich international skalieren oder doch nur einen hübsch lokalisierten .de-Shop mit einer Extraportion Bauchschmerzen betreiben?
Unser Leitfaden zeigt dir, wie es richtig funktioniert. Wir erklären, wie du strategisch zwischen Shopify Markets und Multi-Store-Setups wählst, wie du Content, Compliance und Systeme organisierst und worauf es beim internationalen Go-Live ankommt.
Los geht es bei der Internationalisierung mit Shopify allerdings immer mit einer grundsätzlichen Frage:
Mit Shopify Markets steuerst du dein gesamtes Setup aus einem zentralen Shop. Währungen, Domains, Preise und Steuern lassen sich an den Zielmarkt anpassen, werden aber lokal verwaltet. Ergo: Eine große Schaltstelle, in der alles zusammenläuft. Das kann die Verwaltung vereinfachen, ist aber auch weniger flexibel und nicht für alle Märkte geeignet.
Die Multi-Store-Lösung hingegen setzt auf eigenständige Shopify-Instanzen pro Land, Region oder Marke. Jeder Store ist dabei so unabhängig, wie der Mutterkonzern es gerne hätte; von an-der-kurzen-Leine bis absolut selbstständig. Das garantiert maximale Flexibilität, erfordert aber auch mehr Pflege und Abstimmung.
Welche Lösung die richtige für dein Unternehmen ist, richtet sich zunächst nach deinen Antworten auf diese vier Fragen:
Bist du dagegen ein Multi-Brand-Business oder möchtest deine zentrale Brand auf unterschiedlichen Märkten komplett anders präsentieren, dann heißt deine Strategie Multi-Store.
Weicht dein Sortiment dagegen deutlich ab – etwa weil du für unterschiedliche Länder eigene Produktlinien einführen willst –, dann empfiehlt sich Multi-Store.
Mehrere Rechtseinheiten, unterschiedliche Profit and Losses (P&Ls) und rechtliche Anforderungen pro Land sprechen dagegen klar für Multi-Store.
Erfordert dein Zielland dagegen eigenständige Kampagnen, Sales-Kalender und SEO-Strategien, führt an Multi-Store kein Weg vorbei.
Im hybriden Modell wählst du für das Zielland immer die pragmatischste Lösung. Ein typisches Setup wäre etwa ein zentraler EU-Store mit Shopify Markets im Schengenraum, ergänzt um separate Shops für Länder mit besonderen Anforderungen – wie für das UK und die Schweiz mit ihren eigenen Währungen und Zollgesetzen.
Unserer eigenen Erfahrung nach sind hybride Architekturen meist die sinnvollste Lösung. Insbesondere für stark wachsende mittelständische Unternehmen, die sich in ihrem Business nicht auf Kerneuropa beschränken wollen. Wichtig ist dabei allerdings immer, dass die dahinterliegenden Strukturen, Prozesse und Integrationen das Setup auch tragen. Was uns direkt zu unserem nächsten Punkt führt:
Läuft der Export nach Österreich etwa bereits wie am Schnürchen, sollten keine weiteren überflüssigen Maßnahmen ergriffen werden. Für eine Ausweitung der Geschäfte in der Schweiz können dagegen zusätzliche Schritte sinnvoll sein – allein, weil es dort vier Amtssprachen gibt.
Mache dir daher Gedanken zu diesen Punkten:
Zeichnet sich ab, dass dein Setup auf eine neue juristische Einheit hinausläuft, lässt sich dieser Umstand mit einer Multi-Store-Instanz deutlich einfacher abbilden.
Brauchst du eine saubere Trennung der Finanzdaten, dann wählst du den Multi-Store. Steuerst du die Prozesse dagegen zentral, dann reicht Shopify Markets.
Sagst du also: „Die Kultur ist uns so fremd – besser, das Land bekommt ein eigenes Budget“, spricht das eher für Multi-Store. Bist du dagegen eher der Meinung, dass Weihnachten überall auf der Welt funktioniert, nimmst du Markets.
Shopify Markets kann zwar problemlos mehrere Währungen sowie landesspezifische Steuerregeln managen, allerdings teilen sich dabei alle Märkte dieselbe Zahlungslogik. Das ist natürlich ein gewaltiger Nachteil, wenn du getrennte Buchhaltungsprozesse oder Payout-Flows benötigst.
Multi-Store-Strukturen ermöglichen dagegen separate Abrechnungen, was insbesondere bei mehreren Gesellschaften unerlässlich ist. Willst du dem Finanzamt also nicht erklären, warum die Einnahmen aus deiner OHG und deiner GmbH auf demselben Konto landen, geht es nicht ohne Multi-Store.
Außerdem abermals der Hinweis: Alle Architekturentscheidungen sollten stets gemeinsam mit Steuerberatung und Finance erfolgen. Technische Effizienz darf nie zu buchhalterischer Komplexität führen!
Als einfache Lösung empfehlen wir das RACI-Modell, also: Wer ist für welchen Unternehmensbereich Responsible, Accountable, Consulted oder Informed? Oder auf Deutsch: Wer ist zuständig, rechenschaftspflichtig, zu konsultieren und zu informieren?
In einem kleinen Beispiel: Du besitzt eine Dependance in Frankreich mit einem eigenen kleinen Team. Das RACI könnte für unterschiedliche Prozesse so aussehen:
Wird in Frankreich also ein neues Produkt eingeführt, dann ist die Teamleitung vor Ort dafür verantwortlich, dass alles funktioniert. Das Team selbst kümmert sich um die Umsetzung und konsultiert vorab die deutsche Fachabteilung, um alle Informationen rund um das neue Produkt zu erhalten. Außerdem sagt jemand der Chefin: „Hey Chefin, unser neues Produkt verkaufen wir jetzt auch in Frankreich.“
Die Marketingkampagne zu Weihnachten dagegen wird zentral aus Deutschland gesteuert. Team Frankreich wird lediglich darüber informiert, dass es zum Fest einen Rabatt gibt. Um die Einstellung eines neuen Mitarbeitenden dürfen sich die Franzosen komplett selbst kümmern, denn dafür haben sie ein eigenes Budget.
Mit RACI lassen sich Kompetenzen, Rechte und Pflichten klar aufschlüsseln, zuweisen und darstellen.
Dabei hat sich unserer Erfahrung nach besonders der Content als massiver Fallstrick erwiesen. Denn wenn du deinem Team in Deutschland sagst: „Passt unser Portfolio mal an unsere zwölf neuen Märkte im Ausland an“, dann werden sie unter der Belastung schnell einbrechen.
Deutlich erfolgsversprechender sind diese Schritte:
Den globalen Master-Content: Darunter fallen zum Beispiel Produktbasistexte, Bild-Assets, USPs oder auch Brand-Stories. Dieser Content kann prinzipiell so bleiben, wie er ist, und muss nur übersetzt werden. Wobei „nur“ natürlich ein dehnbarer Begriff ist.
Den lokalen Content: Dieser Content muss für das jeweilige Zielland vollständig neu erstellt werden. Dazu gehören etwa lokale Rechtstexte, Produkthinweise mit Rechtscharakter, lokal angepasste Marketingkampagnen, Markt-Hooks oder auch Testimonials.
Diese Unterteilung reduziert bereits im ersten Schritt den Arbeitsaufwand und vermeidet Redundanzen.
Allerdings: Die sind nicht immer gut. Auch wenn deren Marketing gerne anderes behauptet. KI-generierter Content ist oft ein Phrasengedresche. Der Übersetzung gehen die Nuancen verloren oder sie produziert Kauderwelsch, insbesondere bei weniger oft gesprochenen Sprachen. Ohne Profis geht es bei hochqualitativem Content nicht.
Übersetzungen müssen von Menschen mindestens lektoriert und – etwa bei Rechtstexten – von lokalen Expert:innen überprüft werden. Neuen Content lässt du am besten immer von Texter:innen in der jeweiligen Muttersprache erstellen.
Auch dabei kann eine Rollenverteilung nach dem RACI-Modell hilfreich sein. Wenn etwa viele Übersetzer:innen gleichzeitig an deinen Produkttexten arbeiten (R), sollte es immer eine hauptverantwortliche Person geben, die jeden Text nochmal überprüft und final in die Tonalität deiner Brand bringt (A).
Sehr contentlastige Marken profitieren hier schnell von einem externen Content Management System. Denn tausende Produktbeschreibungen per E-Mail hin- und herzuschicken, ist fehleranfällig und ineffizient.
Zunächst, dass du dir und deinem Team keine doppelte Arbeit machen solltest. Ein notwendiger Warnhinweis zu einem Produkt („Kleinteile können von Kindern verschluckt werden“) wurde schon millionenfach in europäische Sprachen übersetzt. Hier kannst du die KI gerne machen lassen und den Hinweistext dann zentral in die gesamte EU ausrollen.
Guter Content denkt Effizienz allerdings immer noch einen Schritt weiter: Er macht deine PDPs barrierefrei und damit Conversion-stark. Produktbeschreibungen, die sich gut lesen lassen, Buttons, die einen klaren CTA besitzen, Lieferbedingungen, die ohne bürokratisches Blabla auskommen – all das sorgt für mehr Umsatz, denn Barrierefreiheit ist für dich und deine Brand ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Noch ein Grund mehr also, deinen Content nicht der KI anzuvertrauen.
Allerdings führen CMS und Content auch direkt zu:
Vorteil: Klare Bestandsführung und weniger Datenpflege.
Herausforderung: Das Attribut- und Tagging-Konzept wird komplexer und erfordert eine saubere Integration zwischen den Systemen.
Erklärungsbedürftige Artikel verlangen häufig nach der Produktkopie pro Land. Waren, die jeder kennt – etwa Bekleidung –, lassen sich dagegen problemlos als globale Produkte verwalten. Bei einem umfangreichen Produktportfolio kann sich die Kopie pro Land allerdings schnell als zu viel Arbeit erweisen; hier wäre dann der hybride Ansatz am erfolgversprechendsten.
Insgesamt gilt: Ein gut durchdachtes ERP- und PIM-Setup sorgt dafür, dass der internationale Rollout skalierbar und effizient bleibt, ohne dass Datenchaos entsteht. Und eine gute Shopify Plus Agentur denkt ERP und PIM von Anfang an mit.
Aber apropos denken:
Ein Hub wiederum ist eine Software, die Datentypen, ihren Ursprung und ihr Ziel erkennt, automatisch weiterleitet und nötigenfalls so aufbereitet, dass sie am Ende ihrer Reise auch verarbeitet werden können. Im Prinzip also ein Rangierbahnhof, wie ihn die Deutsche Bahn gerne hätte.
Wenn dir das zu abstrakt ist, hilft ein Beispiel:
Stell dir vor, du betreibst einen Onlineshop für Kosmetikprodukte in mehreren Ländern. Dein Setup besteht aus:
Mit iPaaS läuft das automatisch über eine zentrale Plattform:
Außerdem wären da natürlich noch die:
In Märkten mit wenigen Besonderheiten oder bei gut integrierten Systemen kann ein eigenes Setup hingegen effizienter sein. Oder um im Bild zu bleiben: Wenn du eine Hotelübernachtung in der Nachbarstadt buchst, um einfach mal rauszukommen, holst du dir auch keinen Reiseleiter.
Auch die Systeme der meisten Cross-Border-Dienstleister lassen sich in ein iPaaS-System integrieren. Schließlich wird auch dort nur mit Wasser gekocht, respektive auf bekannte Softwarelösungen gesetzt. Meist ist die Anbindung daher eher eine Frage der Kommunikation als eine programmiertechnische Herausforderung.
Was uns zu unserem letzten Punkt rund um die Integrations-Patterns führt:
Mit Shopify Markets lassen sich Steuern, Zölle und Lokalisierungen zentral innerhalb des Store-Systems abbilden. Das minimiert die Komplexität der Systemlandschaft und vereinfacht gegebenenfalls die Integration weiterer Systeme, sorgt aber auch für eine geringere Flexibilität. Markets ist also vor allem für Unternehmen mit wenigen externen Systemen eine adäquate, da schnelle Lösung.
Große Shopify Plus-Stores setzen dagegen auf das Multi-Store-Setup mit der Unified Codebase im Hub. Dort verwaltet ein zentraler Code die Daten für alle Stores und sorgt dafür, dass individuelle Anpassungen je Markt immer möglich bleiben, während die Konsistenz in sämtlichen Systemen gewährleistet wird.
1. Vorbereitungsphase
☐ Markt auswählen: Pilotprojekt vs. größter Markt; Risiken vs. Opportunitätskosten
☐ Zielbild definieren: Umsatzziele, Marketing-Setup
☐ Rechtliche & steuerliche Anforderungen checken (mit Steuerberater)
2. Technische Vorbereitung
☐ Domain/URL-Struktur je Land festlegen (Subfolder vs. ccTLD vs. Subdomain) – wichtig für internationale SEO
☐ Market oder neuen Store anlegen, Grundkonfiguration prüfen:
☐ Währung, Steuern, Versandzonen
☐ Lokale Payment-Provider
☐ Anbindung an ERP, PIM, WMS, Tax Engine testen (Bestellungen End-to-End durchspielen)
3. Content & UX
☐ Produkt- & Kategorietexte übersetzen/lokalisieren
☐ Rechtstexte (AGB, Widerruf, Datenschutz) lokal einspielen
☐ UX-Basics prüfen: Währung, Sprache, Versandkosten und Lieferzeit gut sichtbar?
4. Tracking & Reporting
☐ Analytics, Server-Side-Tracking/Cookieless-Setup prüfen (mehr dazu findest du hier)
☐ KPI-Set definieren: Conversion Rate, AOV, CAC, CLV
5. Soft-Launch & Iteration
☐ Interner Test & begrenzter Launch (z.B. nur über Newsletter/bestimmte Kampagnen)
☐ Feedbackschleifen mit lokaler Customer Experience
☐ Alles dokumentieren, um das nächste Land schneller ausrollen zu können
Schreib also einfach unseren Profis für die Internationalisierung, erkläre uns in ein paar kurzen Sätzen, worum es geht, und wir melden uns bei dir, um einen Termin für ein ausführliches Erstgespräch zu vereinbaren. Kostenlos und unverbindlich.
Ach, und übrigens: Der Store aus der Einleitung zu diesem Beitrag war gar nicht fiktiv. Den gibt es wirklich, und nachdem dort alles den Bach runterging, hat er sich bei uns gemeldet. Inzwischen soll dort Japan als neues Zielland in den Fokus genommen werden.
Die Ernüchterung folgt direkt im Anschluss. Die Conversion Rates in den internationalen Stores sind miserabel, die Buchhaltung kämpft mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen, das ERP-System versteht die neue Datenvielfalt nicht, der Support probt den Aufstand, weil er komplett überfordert ist, und im Briefkasten liegen Abmahnungen wegen fehlender Rechtstexte. So sollte das mit der Internationalisierung nicht laufen …
Falls du dich gerade in einer ähnlichen Situation befindest, stellt sich also die Frage: Willst du mit Shopify wirklich international skalieren oder doch nur einen hübsch lokalisierten .de-Shop mit einer Extraportion Bauchschmerzen betreiben?
Unser Leitfaden zeigt dir, wie es richtig funktioniert. Wir erklären, wie du strategisch zwischen Shopify Markets und Multi-Store-Setups wählst, wie du Content, Compliance und Systeme organisierst und worauf es beim internationalen Go-Live ankommt.
Los geht es bei der Internationalisierung mit Shopify allerdings immer mit einer grundsätzlichen Frage:
Diese Themen findest du im Folgenden:
- Gewichtete Entscheidung: Shopify Markets oder Multi-Store-Lösung?
- Strukturentscheidungen: Governance & Finance
- Content-Ops: Märkte bespielen, ohne das Team zu verbrennen
- ERP- und PIM-Modellierung: So behältst du den Überblick
- Alles zusammenführen: Integrations-Patterns
- Das Finale: Go-Live, go Checklist
- International skalieren mit Shopify und dem richtigen Partner
Gewichtete Entscheidung: Shopify Markets oder Multi-Store-Lösung?
Um dein Business international aufzustellen, stehen dir auf Shopify zwei zentrale Wege offen: Entweder du nutzt Shopify Markets (aber intelligenter als unser Beispielunternehmen aus der Einleitung) oder du greifst auf die Multi-Store-Lösung zurück. Als kurze Erklärung:Mit Shopify Markets steuerst du dein gesamtes Setup aus einem zentralen Shop. Währungen, Domains, Preise und Steuern lassen sich an den Zielmarkt anpassen, werden aber lokal verwaltet. Ergo: Eine große Schaltstelle, in der alles zusammenläuft. Das kann die Verwaltung vereinfachen, ist aber auch weniger flexibel und nicht für alle Märkte geeignet.
Die Multi-Store-Lösung hingegen setzt auf eigenständige Shopify-Instanzen pro Land, Region oder Marke. Jeder Store ist dabei so unabhängig, wie der Mutterkonzern es gerne hätte; von an-der-kurzen-Leine bis absolut selbstständig. Das garantiert maximale Flexibilität, erfordert aber auch mehr Pflege und Abstimmung.
Noch zu abstrakt? Dann erklären wir dir gerne die Basics zur Internationalisierung mit Shopify Markets.
Welche Lösung die richtige für dein Unternehmen ist, richtet sich zunächst nach deinen Antworten auf diese vier Fragen:
Frage #1: Hast du eine Brand oder mehrere?
Führst du nur eine Marke im Portfolio und soll diese weltweit auch noch gleich präsentiert und wahrgenommen werden, dann eignet sich Shopify Markets besser für dich.Bist du dagegen ein Multi-Brand-Business oder möchtest deine zentrale Brand auf unterschiedlichen Märkten komplett anders präsentieren, dann heißt deine Strategie Multi-Store.
Frage #2: Wie stark weicht dein Sortiment pro Zielland ab?
Wenn 80 bis 100 Prozent deines Sortiments weltweit identisch sind, dann führt dich dein Weg zu Shopify Markets.Weicht dein Sortiment dagegen deutlich ab – etwa weil du für unterschiedliche Länder eigene Produktlinien einführen willst –, dann empfiehlt sich Multi-Store.
Frage #3: Wie komplex sind Steuern & Compliance?
Eine EU-Entität mit One Stop Shop (OSS) und überschaubaren Spezialfällen kommt mit Shopify Markets meist gut zurecht.Mehrere Rechtseinheiten, unterschiedliche Profit and Losses (P&Ls) und rechtliche Anforderungen pro Land sprechen dagegen klar für Multi-Store.
Frage #4: Wie wichtig ist eine maximale Lokalisierung?
Reicht eine gute Übersetzung inklusive der lokalen Währung aus, weil die kulturellen Unterschiede nicht besonders groß sind? Dann genügt Shopify Markets.Erfordert dein Zielland dagegen eigenständige Kampagnen, Sales-Kalender und SEO-Strategien, führt an Multi-Store kein Weg vorbei.
Meist die sinnvollste Alternative: Hybride Lösungen
Natürlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass einige Antworten dich zu Shopify Markets führen, während andere dir das Multi-Store-Setup ans Herz legen. Entweder gewichtest du das Ganze jetzt – sagst also zum Beispiel: „Die USA sind uns kulturell zwar ähnlich, haben aber völlig andere Compliance-Anforderungen. Ohne Multi-Store geht es da nicht.“ – oder du schlägst einen Zwischenweg ein: das hybride Modell.Im hybriden Modell wählst du für das Zielland immer die pragmatischste Lösung. Ein typisches Setup wäre etwa ein zentraler EU-Store mit Shopify Markets im Schengenraum, ergänzt um separate Shops für Länder mit besonderen Anforderungen – wie für das UK und die Schweiz mit ihren eigenen Währungen und Zollgesetzen.
Unserer eigenen Erfahrung nach sind hybride Architekturen meist die sinnvollste Lösung. Insbesondere für stark wachsende mittelständische Unternehmen, die sich in ihrem Business nicht auf Kerneuropa beschränken wollen. Wichtig ist dabei allerdings immer, dass die dahinterliegenden Strukturen, Prozesse und Integrationen das Setup auch tragen. Was uns direkt zu unserem nächsten Punkt führt:
Strukturentscheidungen: Governance & Finance
Um eine fundierte Entscheidung zwischen Markets und Multi-Store je Zielland treffen zu können, müssen die Shops alle lokalen Rahmenbedingungen des Marktes abbilden können, ohne dafür bestehende Synergien zu opfern.Läuft der Export nach Österreich etwa bereits wie am Schnürchen, sollten keine weiteren überflüssigen Maßnahmen ergriffen werden. Für eine Ausweitung der Geschäfte in der Schweiz können dagegen zusätzliche Schritte sinnvoll sein – allein, weil es dort vier Amtssprachen gibt.
Mache dir daher Gedanken zu diesen Punkten:
Rechtliche Strukturen und P&L
Natürlich können wir dir in diesem Beitrag keine Rechts- oder Finanzberatung bieten. Trotzdem möchten wir dich auf ein paar zentrale Fragen hinweisen, die für eine Entscheidung zwischen Markets und Multi-Store absolut relevant sind:Wie viele juristische Einheiten gibt es und welche sind notwendig?
Bleibt es bei der GmbH in Deutschland oder ist es für das Zielland notwendig (oder sinnvoll), eine neue rechtliche Entität zu gründen? Dabei spielen Rechtsvorschriften natürlich eine große Rolle, aber auch steuerliche Aspekte oder einfach eine ordentliche Portion Patriotismus. Die USA etwa hätten momentan ja gerne, dass jedes Konsumgut Made in America ist …Zeichnet sich ab, dass dein Setup auf eine neue juristische Einheit hinausläuft, lässt sich dieser Umstand mit einer Multi-Store-Instanz deutlich einfacher abbilden.
Wer trägt die Kosten je Land und fährt die Umsätze ein?
Bei dieser Frage geht es nicht nur um die Buchhaltung – zentral oder lieber getrennt –, sondern auch um Steuern, Bilanzen und Statistiken. Denn wenn ein Store im Ausland finanziell komplett unabhängig agiert, lassen sich zum Beispiel auch die Erfolge von Werbekampagnen, SEO-Maßnahmen oder Produktneueinführungen deutlich einfacher auslesen.Brauchst du eine saubere Trennung der Finanzdaten, dann wählst du den Multi-Store. Steuerst du die Prozesse dagegen zentral, dann reicht Shopify Markets.
Gibt es zentrale oder lokale Budgets für Marketing und Discounts?
Die Frage klingt ähnlich wie die vorangegangene, hat aber eher einen kulturellen Hintergrund. Denn falls du im Malaysiaurlaub mal den Fernseher eingeschaltet hast: Die bewerben ihre Produkte ganz anders als wir. Auch Discounts können stark von lokalen Gepflogenheiten abhängen. Wie groß feiert Thailand eigentlich den Geburtstag seines Monarchen und gibt es dann Rabatte?Sagst du also: „Die Kultur ist uns so fremd – besser, das Land bekommt ein eigenes Budget“, spricht das eher für Multi-Store. Bist du dagegen eher der Meinung, dass Weihnachten überall auf der Welt funktioniert, nimmst du Markets.
Lesetipp: Oft besser als Neukunden-Marketing: So erhöhst du den Warenkorbwert über den ROAS direkt in deinem Store.
Währungen, Payouts & Buchhaltung
Rund um alle finanziellen Aspekte musst du weiterhin Folgendes auf dem Schirm haben:Shopify Markets kann zwar problemlos mehrere Währungen sowie landesspezifische Steuerregeln managen, allerdings teilen sich dabei alle Märkte dieselbe Zahlungslogik. Das ist natürlich ein gewaltiger Nachteil, wenn du getrennte Buchhaltungsprozesse oder Payout-Flows benötigst.
Multi-Store-Strukturen ermöglichen dagegen separate Abrechnungen, was insbesondere bei mehreren Gesellschaften unerlässlich ist. Willst du dem Finanzamt also nicht erklären, warum die Einnahmen aus deiner OHG und deiner GmbH auf demselben Konto landen, geht es nicht ohne Multi-Store.
Außerdem abermals der Hinweis: Alle Architekturentscheidungen sollten stets gemeinsam mit Steuerberatung und Finance erfolgen. Technische Effizienz darf nie zu buchhalterischer Komplexität führen!
Lesetipp: Immer ein Teil der Buchhaltung: Die Customer Acquisition Costs. Wir erklären dir mehr zu dieser wichtigen KPI.
Governance
Abschließend stellt sich noch die Frage, wer die Entscheidungshoheit über die unterschiedlichen Aspekte deines Business besitzt. Bestimmt das Landesteam über die Preislisten oder die Zentrale in Deutschland? Wer darf Produkte freigeben oder bestimmen, für welche Werbemaßnahmen welcher Betrag ausgegeben wird?Als einfache Lösung empfehlen wir das RACI-Modell, also: Wer ist für welchen Unternehmensbereich Responsible, Accountable, Consulted oder Informed? Oder auf Deutsch: Wer ist zuständig, rechenschaftspflichtig, zu konsultieren und zu informieren?
In einem kleinen Beispiel: Du besitzt eine Dependance in Frankreich mit einem eigenen kleinen Team. Das RACI könnte für unterschiedliche Prozesse so aussehen:
| Geschäftsführung Deutschland | Fachabteilung Deutschland | Teamleitung Frankreich | Team Frankreich | |
| Produkteinführung in Frankreich | I | C | A | R |
| Marketing zu Weihnachten | A | R | I | |
| Neueinstellung Frankreich | A | R |
Wird in Frankreich also ein neues Produkt eingeführt, dann ist die Teamleitung vor Ort dafür verantwortlich, dass alles funktioniert. Das Team selbst kümmert sich um die Umsetzung und konsultiert vorab die deutsche Fachabteilung, um alle Informationen rund um das neue Produkt zu erhalten. Außerdem sagt jemand der Chefin: „Hey Chefin, unser neues Produkt verkaufen wir jetzt auch in Frankreich.“
Die Marketingkampagne zu Weihnachten dagegen wird zentral aus Deutschland gesteuert. Team Frankreich wird lediglich darüber informiert, dass es zum Fest einen Rabatt gibt. Um die Einstellung eines neuen Mitarbeitenden dürfen sich die Franzosen komplett selbst kümmern, denn dafür haben sie ein eigenes Budget.
Mit RACI lassen sich Kompetenzen, Rechte und Pflichten klar aufschlüsseln, zuweisen und darstellen.
Content-Ops: Märkte bespielen, ohne das Team zu verbrennen
Inzwischen sollte klar sein, ob es für dich Shopify Markets, das Multi-Store-Setup oder das hybride Modell wird, welche Rechtsformen und Buchhaltungsstrukturen sinnvoll bis notwendig sind und wer wofür die Verantwortung trägt. Jetzt geht es in die Umsetzung.Dabei hat sich unserer Erfahrung nach besonders der Content als massiver Fallstrick erwiesen. Denn wenn du deinem Team in Deutschland sagst: „Passt unser Portfolio mal an unsere zwölf neuen Märkte im Ausland an“, dann werden sie unter der Belastung schnell einbrechen.
Deutlich erfolgsversprechender sind diese Schritte:
Klare Trennung in der Content-Architektur
Zunächst wird der gesamte Content deines Stores in zwei Kategorien aufgeteilt. Es gibt:Den globalen Master-Content: Darunter fallen zum Beispiel Produktbasistexte, Bild-Assets, USPs oder auch Brand-Stories. Dieser Content kann prinzipiell so bleiben, wie er ist, und muss nur übersetzt werden. Wobei „nur“ natürlich ein dehnbarer Begriff ist.
Den lokalen Content: Dieser Content muss für das jeweilige Zielland vollständig neu erstellt werden. Dazu gehören etwa lokale Rechtstexte, Produkthinweise mit Rechtscharakter, lokal angepasste Marketingkampagnen, Markt-Hooks oder auch Testimonials.
Diese Unterteilung reduziert bereits im ersten Schritt den Arbeitsaufwand und vermeidet Redundanzen.
Lesetipp: Guter Content ist eine der besten Methoden, um den Customer Lifetime Value zu steigern. Welche es noch gibt, verrät dir dieser Beitrag.
Nutze Tools sinnvoll, verteile Rollen
Im nächsten Schritt geht es an die Übersetzung, respektive die Neuerstellung des Contents. Klar, dass dir dabei die Software gehörig Schützenhilfe leisten kann. Tools zum Übersetzen und Texte verfassen gibt es inzwischen jede Menge, zum Beispiel Shopify Translate, Adapt oder Langify.Allerdings: Die sind nicht immer gut. Auch wenn deren Marketing gerne anderes behauptet. KI-generierter Content ist oft ein Phrasengedresche. Der Übersetzung gehen die Nuancen verloren oder sie produziert Kauderwelsch, insbesondere bei weniger oft gesprochenen Sprachen. Ohne Profis geht es bei hochqualitativem Content nicht.
Übersetzungen müssen von Menschen mindestens lektoriert und – etwa bei Rechtstexten – von lokalen Expert:innen überprüft werden. Neuen Content lässt du am besten immer von Texter:innen in der jeweiligen Muttersprache erstellen.
Lesetipp dazu: Eine gute Customer Experience ist kein nebulöser Wert, sondern kann wie jede KPI gemessen werden. Wir zeigen dir, wie du dabei vorgehst.
Auch dabei kann eine Rollenverteilung nach dem RACI-Modell hilfreich sein. Wenn etwa viele Übersetzer:innen gleichzeitig an deinen Produkttexten arbeiten (R), sollte es immer eine hauptverantwortliche Person geben, die jeden Text nochmal überprüft und final in die Tonalität deiner Brand bringt (A).
Sehr contentlastige Marken profitieren hier schnell von einem externen Content Management System. Denn tausende Produktbeschreibungen per E-Mail hin- und herzuschicken, ist fehleranfällig und ineffizient.
Denke an die Effizienzhebel
Was meinen wir mit Effizienzhebeln?Zunächst, dass du dir und deinem Team keine doppelte Arbeit machen solltest. Ein notwendiger Warnhinweis zu einem Produkt („Kleinteile können von Kindern verschluckt werden“) wurde schon millionenfach in europäische Sprachen übersetzt. Hier kannst du die KI gerne machen lassen und den Hinweistext dann zentral in die gesamte EU ausrollen.
Guter Content denkt Effizienz allerdings immer noch einen Schritt weiter: Er macht deine PDPs barrierefrei und damit Conversion-stark. Produktbeschreibungen, die sich gut lesen lassen, Buttons, die einen klaren CTA besitzen, Lieferbedingungen, die ohne bürokratisches Blabla auskommen – all das sorgt für mehr Umsatz, denn Barrierefreiheit ist für dich und deine Brand ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Noch ein Grund mehr also, deinen Content nicht der KI anzuvertrauen.
Allerdings führen CMS und Content auch direkt zu:
ERP- und PIM-Modellierung: So behältst du den Überblick
Zur Internationalisierung gehört immer auch die Frage: Wie organisiere ich Produkte und Daten zwischen ERP und PIM möglichst effizient? Grundsätzlich kommen unterschiedliche Herangehensweisen infrage:Globales Produkt, marktspezifische Attribute
In ERP und PIM existiert nur ein zentraler Artikel, während in Shopify über Varianten oder Metafelder die länderspezifischen Informationen abgebildet werden.Vorteil: Klare Bestandsführung und weniger Datenpflege.
Herausforderung: Das Attribut- und Tagging-Konzept wird komplexer und erfordert eine saubere Integration zwischen den Systemen.
Produktkopien pro Land
Sowohl im PIM als auch im ERP werden für jeden Markt jeweils eigene Artikel angelegt. Die länderspezifischen Informationen zieht sich Shopify aus den externen Datenbanken.- Vorteil: Maximale Flexibilität bei Content, Preisen und rechtlichen Anforderungen.
- Herausforderung: Gefahr der berüchtigten Daten-Spaghetti. Preise, Bilder und Bestände müssen in allen Kopien synchron gehalten werden.
Hybrider Ansatz
Auch für PIM und ERP gibt es hybride Lösungen. Unser Kunde Lavera etwa besitzt in seinen PIMs für jedes Land eine eigene Kopie für jedes Produkt. Im zentralen ERP dagegen findet sich jedes Produkt nur einmal. Denn viele Informationen – wie etwa die meisten Zahlen rund um einen Artikel – bleiben identisch und können zentral verwaltet werden.- Vorteil: Basale Informationen werden zentral gesteuert und verwaltet; Flexibilität bei länderspezifischen Daten bleibt hoch.
- Herausforderung: Sorgfalt bei der technischen Anbindung: Die APIs zwischen ERP, PIMS und Stores müssen perfekt arbeiten, sonst ist das Datenchaos vorprogrammiert.
Welche Lösung ist die beste?
Wie so oft müssen wir mit dem schönen Satz antworten: Es kommt darauf an. Die Wahl des Modells hängt stark von Produktvielfalt, Marktanforderungen und Ressourcen ab.Erklärungsbedürftige Artikel verlangen häufig nach der Produktkopie pro Land. Waren, die jeder kennt – etwa Bekleidung –, lassen sich dagegen problemlos als globale Produkte verwalten. Bei einem umfangreichen Produktportfolio kann sich die Kopie pro Land allerdings schnell als zu viel Arbeit erweisen; hier wäre dann der hybride Ansatz am erfolgversprechendsten.
Insgesamt gilt: Ein gut durchdachtes ERP- und PIM-Setup sorgt dafür, dass der internationale Rollout skalierbar und effizient bleibt, ohne dass Datenchaos entsteht. Und eine gute Shopify Plus Agentur denkt ERP und PIM von Anfang an mit.
Aber apropos denken:
Alles zusammenführen: Integrations-Patterns
Bevor ein Onlineshop international ausgerollt wird, sollte final die Systemlandschaft klar skizziert werden. Dazu gehören nicht nur ERP, PIM und natürlich Shopify selbst, sondern auch WMS, CRM, Tax Engines, Payment-Provider und sogar Marktplätze. Dabei kommen grundsätzlich zwei Varianten infrage:- Die Direktanbindung jedes einzelnen Stores an die restliche Systemlandschaft – das ist der klassische Weg.
- Oder eine Middleware beziehungsweise Integration Platform as a Service (iPaaS) – das ist der moderne Weg über Connected Commerce.
Was ist iPaaS?
Einfach gesprochen ist iPaaS eine Cloud-basierte Plattform, die verschiedene Systeme, Anwendungen und Datenquellen miteinander verbindet, ohne dass jede Schnittstelle zwischen den Komponenten einzeln programmiert werden muss. Es fungiert als ein zentraler Hub, über den Daten zwischen ERP, PIM, CRM, Shopify, Marktplätzen und anderen Systemen fließen können.Ein Hub wiederum ist eine Software, die Datentypen, ihren Ursprung und ihr Ziel erkennt, automatisch weiterleitet und nötigenfalls so aufbereitet, dass sie am Ende ihrer Reise auch verarbeitet werden können. Im Prinzip also ein Rangierbahnhof, wie ihn die Deutsche Bahn gerne hätte.
Wenn dir das zu abstrakt ist, hilft ein Beispiel:
Stell dir vor, du betreibst einen Onlineshop für Kosmetikprodukte in mehreren Ländern. Dein Setup besteht aus:
- Shopify für den Onlineshop
- ERP für Lager, Bestände und Rechnungen
- PIM für Produktinformationen und Übersetzungen
- Payment-Provider für Zahlungen
- Shipping-Partner für den Versand
Mit iPaaS läuft das automatisch über eine zentrale Plattform:
- Shopify schickt die Bestellung an den Hub.
- Der Hub synchronisiert automatisch die Produktinformationen aus dem PIM:
- Das ERP erhält alle Bestelldaten inklusive Mengen, Kundendaten und Rechnungsinfos.
- Der Payment-Provider wird über die Zahlung informiert.
- Der Versandpartner bekommt die Lieferdetails.
Außerdem wären da natürlich noch die:
Cross-Border-Dienstleister
Für die Abwicklung von Zoll, Steuern und länderspezifischer Logistik ist es häufig sinnvoll, Cross-Border-Dienstleister wie Global-e oder ESW hinzuzuziehen. Insbesondere dann, wenn du viele kleine Länder bedienen willst oder in deinen Zielländern komplexe Steuer- und Zollthemen auftreten sollten. Es ist wie im Urlaub: Richtig gut wird die Reise dann, wenn Einheimische dich durchs Land führen.In Märkten mit wenigen Besonderheiten oder bei gut integrierten Systemen kann ein eigenes Setup hingegen effizienter sein. Oder um im Bild zu bleiben: Wenn du eine Hotelübernachtung in der Nachbarstadt buchst, um einfach mal rauszukommen, holst du dir auch keinen Reiseleiter.
Auch die Systeme der meisten Cross-Border-Dienstleister lassen sich in ein iPaaS-System integrieren. Schließlich wird auch dort nur mit Wasser gekocht, respektive auf bekannte Softwarelösungen gesetzt. Meist ist die Anbindung daher eher eine Frage der Kommunikation als eine programmiertechnische Herausforderung.
Was uns zu unserem letzten Punkt rund um die Integrations-Patterns führt:
Mapping nach Shopify-Architektur
Welches Integrationsmodell das richtige für dich ist, hängt auch hier von der Produktvielfalt, den Zielmärkten und deinen verfügbaren organisatorischen Ressourcen ab.Mit Shopify Markets lassen sich Steuern, Zölle und Lokalisierungen zentral innerhalb des Store-Systems abbilden. Das minimiert die Komplexität der Systemlandschaft und vereinfacht gegebenenfalls die Integration weiterer Systeme, sorgt aber auch für eine geringere Flexibilität. Markets ist also vor allem für Unternehmen mit wenigen externen Systemen eine adäquate, da schnelle Lösung.
Große Shopify Plus-Stores setzen dagegen auf das Multi-Store-Setup mit der Unified Codebase im Hub. Dort verwaltet ein zentraler Code die Daten für alle Stores und sorgt dafür, dass individuelle Anpassungen je Markt immer möglich bleiben, während die Konsistenz in sämtlichen Systemen gewährleistet wird.
Du brauchst noch mehr Details? Dann studierst du am besten unseren Beitrag mit unserem Internationalisierungsprofi Christian Hensen.
Das Finale: Go-Live, go Checklist
Ganz schön viel zu tun für so eine erfolgreiche Internationalisierung. Damit du auch ja nichts vergisst, präsentieren wir dir zu guter Letzt unsere Checkliste für deinen Eintritt in den globalen Markt.1. Vorbereitungsphase
☐ Markt auswählen: Pilotprojekt vs. größter Markt; Risiken vs. Opportunitätskosten
☐ Zielbild definieren: Umsatzziele, Marketing-Setup
☐ Rechtliche & steuerliche Anforderungen checken (mit Steuerberater)
2. Technische Vorbereitung
☐ Domain/URL-Struktur je Land festlegen (Subfolder vs. ccTLD vs. Subdomain) – wichtig für internationale SEO
☐ Market oder neuen Store anlegen, Grundkonfiguration prüfen:
☐ Währung, Steuern, Versandzonen
☐ Lokale Payment-Provider
☐ Anbindung an ERP, PIM, WMS, Tax Engine testen (Bestellungen End-to-End durchspielen)
3. Content & UX
☐ Produkt- & Kategorietexte übersetzen/lokalisieren
☐ Rechtstexte (AGB, Widerruf, Datenschutz) lokal einspielen
☐ UX-Basics prüfen: Währung, Sprache, Versandkosten und Lieferzeit gut sichtbar?
4. Tracking & Reporting
☐ Analytics, Server-Side-Tracking/Cookieless-Setup prüfen (mehr dazu findest du hier)
☐ KPI-Set definieren: Conversion Rate, AOV, CAC, CLV
5. Soft-Launch & Iteration
☐ Interner Test & begrenzter Launch (z.B. nur über Newsletter/bestimmte Kampagnen)
☐ Feedbackschleifen mit lokaler Customer Experience
☐ Alles dokumentieren, um das nächste Land schneller ausrollen zu können
Was noch fehlt, sind Referenzen und Beispiele. Lies daher gerne unsere Case Studies mit VOSSEN und ORTLIEB und sieh dir an, wie eine erfolgreiche Internationalisierung auf Shopify aussehen kann.
International skalieren mit Shopify und dem richtigen Partner
Na, schon überall einen Haken gesetzt? Vermutlich nicht, denn so ein Internationalisierungsprojekt ist schließlich keine kleine Angelegenheit. Deutlich einfacher wird es, wenn du dir Unterstützung mit ins Boot holst. Am besten eine Shopify Plus Agentur, die schon viele Unternehmen beim Gang über die Grenze begleitet hat – von der Markteintrittsstrategie bis zum Go-Live – und sich nicht nur um deinen Store, sondern auch um die Integration deiner kompletten Systemlandschaft kümmert.Schreib also einfach unseren Profis für die Internationalisierung, erkläre uns in ein paar kurzen Sätzen, worum es geht, und wir melden uns bei dir, um einen Termin für ein ausführliches Erstgespräch zu vereinbaren. Kostenlos und unverbindlich.
Ach, und übrigens: Der Store aus der Einleitung zu diesem Beitrag war gar nicht fiktiv. Den gibt es wirklich, und nachdem dort alles den Bach runterging, hat er sich bei uns gemeldet. Inzwischen soll dort Japan als neues Zielland in den Fokus genommen werden.